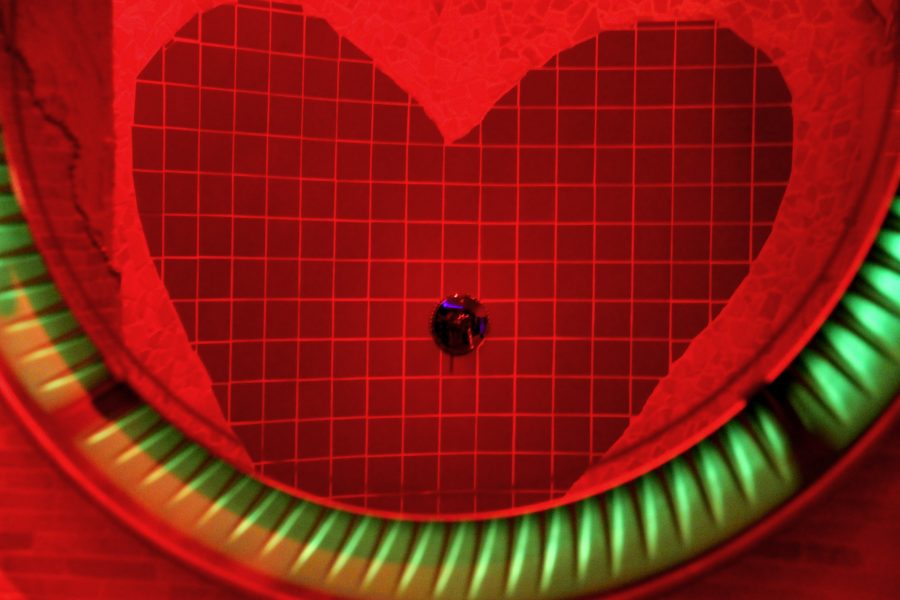Der kleine Kiezkönig oder: Vom Glück zu tanzen. Ein Bordellbesuch.
Im Bordell: Früher ging ich jeden Tag an der kleinen Rotlichtmeile unserer Stadt vorbei. Eines Tages ging ich einfach rein. Eine ausführliche Reportage.
„Muss man nicht glücklich sein, um zu tanzen?“ Das ist so einer dieser Sätze, die bei mir hängen geblieben sind. Ich weiß nicht genau, warum – ich nehme an, wegen der Situation: Sarah sagte den Satz, Sarah, in die ich mich auf Sansibar ein bisschen verliebte, was allerdings dann später, in Amsterdam, nach der Landung, vergleichsweise schnell wieder aufhörte. Den Satz sagte sie mittendrin, ich glaube, in Nairobi.
Wir waren in die roten Sitzecken eines Clubs namens „Paradise“ eingesunken und tranken viel zu billigen Gin-Tonic. Ein Taxifahrer hatte uns ungefragt hingefahren. Der Laden sah von innen aus wie ein zweistöckiges Ufo, an den Wänden konkav geschwungene LED-Konstruktionen, deren Farbwechselsequenz mir die Augen tränen ließ. Alles dröhnte von diesem Reggae-Dancehall-Zeug, das sich nur in tropischem Klima gut anhört. Unten, auf der Tanzfläche, tanzten fünf verdächtig junge schwarze Frauen eng an verdächtig alte weiße Männer geschmiegt. Sarah sah sie. Sarah sagte ihren Satz. Selbstverständlich meinte Sarah ihren Satz als Metapher, sie ist einer dieser Menschen, die immer alles als Metapher meinen, auch wenn sie nicht wollen. Ich sagte: Ich kann dazu nichts sagen. Ich tanze nicht.
Die Begrüßerin
Der Hildesheimer Nightclub „Baccara“ ist leer, tatsächlich leer, bis auf eine blödsinnig vor sich hin blinkende Lichtschlange an einer silbernen Tanzstange. Rot. Grün. Gelb. Grün. Weiß. Rot. Heinz Rudolf sollte eigentlich hier sein, der Besitzer des „Haus Rose“, aber der kommt später, sagt eine mittelalte, blonde Frau. Sie heißt Laila, aber bevor sie ihren Namen sagt, sagt sie: „Herzlich Willkommen. Wie wäre es mit einem Bier?“ Sie war mal Tänzerin, im „Baccara“, davor auf der Reeperbahn, aber das ist schon eine Weile her: Laila tanzt nicht mehr. Sie begrüßt. Das ist, sagt sie, der wichtigste Job in dem Laden: Sie ist diejenige, die die Tür öffnet, wenn jemand klingelt, ihn hineinbittet, die Gäste nach ihren Wünschen fragt, diese Wünsche erfüllt. Mit anderen Worten: Sie bugsiert selbst den schüchternsten „Erstgast“ – ihr Wort – in den Laden herein Und lässt ihn möglichst nicht wieder hinaus. Sie hat einen leichten Akzent, irgendetwas Ostiges – Polen, Rumänien, vielleicht. Und bei näherem Hinsehen sind ihre Haare blondiert, nicht exzessiv, nur ein wenig. Es sieht nicht aus, als wolle sie blond sein, es sieht eher aus, als sei sie mit ihrer natürlichen Haarfarbe nicht zufrieden.
„Die Gäste“, sagt sie, „kommen hierher, weil sie Gesellschaft wollen. Wir bieten ihnen Gesellschaft.“ Frauen, die sich gerne mal ein Getränk ausgeben lassen. Manchmal wollen die Gäste reden. Manchmal wollen sie, dass eine Frau an der Stange tanzt. Manchmal wollen sie mehr, dann können sie mit den Frauen hochgehen, in die Zimmer.
Eine andere Frau, ebenfalls blondiert, aber viel mehr davon, stöckelt vorbei. Sie trägt ein weißes Kleid, vielleicht auch nur ein langes Top, ein Kleidungsstück, jedenfalls, das aufhört, kurz bevor ihr Hintern aufhört. Sie bleibt kurz stehen und lächelt Laila zu. An der Tür klingelt es, und Laila muss aufstehen, den ersten richtigen Gast des Abends begrüßen, vorher aber möchte sie noch ein paar Getränke vorbeibringen.
Magst du noch was?, fragt sie. Sie schaut einem dabei in die Augen. Ich schaue weg. Ein Beck’s, sage ich, und Laila stakst davon, ich starre auf die LED-Lichter an der Tanzstange – rot, grün, gelb, usw., auf das Foto einer Bikini-Frau unter Palmen dahinter, das über ein Fenster geklebt ist: Es sieht aus, als hätte es jemand aus einem TUI-Katalog ausgeschnitten. Sehnsuchtsort „Schöne Frau in Bikini“ an Sehnsuchtsort „Palmenstrand2. Langweilig, aber es wirkt. Die Musik ist irgendein Hip-Hop-Teil, in dem das Gitarrenriff aus „Eye of the Tiger“ gesampelt ist. Dad. Daddaddad. Daddaddad. Daddaddaaa. Ich trinke mein erstes Beck’s aus, und frage mich, wie viel das jetzt eigentlich kostet. Kein Mensch hat den Bierpreis erwähnt, oder überhaupt irgendwelche Getränkepreise. Laila schaut einen nur an und füllt nach. Sie lullt einen ein mit ihrer Nettigkeit, mit ihrem Lächeln, mit ihrer Freundlichkeit. Ich will, dass du dich hier wohlfühlst, sagt sie, wir sind doch hier Freunde, und unter Freunden redet man nicht übers Geld. Ich frage mich, wie es auf meinem Konto aussieht, und ob ich hier mit Karte zahlen kann.
„Man zahlt hier“, sagt Laila, „nicht nur für die Getränke.“ Man zahlt für die Unterhaltung. Man gibt den Frauen Getränke aus. Sie bevorzugen das Teuerste, was der Laden zu bieten hat, ein Glas Champagner für 25 Euro. Die Frauen verdienen an jedem Getränk mit. Die Gäste bekommen dafür etwas, das Laila „Service“ nennt, sie sagt: „Wenn du eine Frau in einer normalen Bar fragst, ob du ihr ein Getränk ausgeben kannst, und direkt danach, ob sie für dich tanzt und dann mit dir schläft, wenn du ihr genug Geld dafür gibst, bekommst du wahrscheinlich eine Ohrfeige. Hier nicht.“
Hier nicht. Hier kannst du sie an der Stange tanzen lassen, du kannst mit ihr hinten ins Separée gehen, vom Rest des Ladens getrennt durch einen halb durchsichtigen lila Vorhang, und sie setzt sich dort auf deinen Schoß. Du kannst dich mit hochnehmen lassen, in den ersten Stock, und dann macht Laila, oder wer eben gerade hinter der Bar steht, eine der Eieruhren an, die dort aufgereiht stehen. Irgendwie muss man ja den Überblick behalten.
Das Verb wird immer absurder
Muss man nicht glücklich sein, um zu tanzen? Ich denke nicht zum ersten Mal an den Satz, und nicht zum letzten Mal. Ich würde das gerne die Frauen fragen, die in dem weißen, zu kurzen Kleidungsstück. Diejenigen, die ich später noch treffe. Aber im Laufe des Abends ändert sich das Verb und die Frage wird immer absurder, immer rhetorischer: Muss man nicht glücklich sein, um zu reden? Muss man nicht. Um zu tanzen? Vermutlich ist es komplizierter als das. Um zu ficken? Selbst wenn niemand dafür bezahlt wird, selbst wenn man ficken durch harmlosere, banalere Wendungen ersetzt – Liebe machen, miteinander schlafen, diese Dinge – sind die Gründe doch immer eigenartiger als das. Mit Geld wird es wahrscheinlich nicht einfacher. Um zu peitschen? Bestimmt nicht. Im Gegenteil. Oder vielleicht doch. Ich kann dazu nichts sagen. Ich peitsche nicht. Ich lasse nicht peitschen.
Vielleicht war ich naiv, damals im „Paradise“ in Nairobi, weil ich ein wenig verliebt war, aber vielleicht war es auch, weil wir von oben auf die Szene schauten – was vermutlich nicht die beste Perspektive ist – aber Sarahs Satz kam mir nicht dumm vor. Sie ging dann tanzen, später, trotzig, wie es ihre Art ist. Ich blieb oben, in unserer roten Gin-Tonic-Ecke, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir ein Unterschied auffiel in der Art, wie sie tanzten, Sarah und die Pärchen. Die jungen, schwarzen Frauen bewegten sich zwar geschmeidiger, mit mehr Tanzerfahrung, aber die alten, weißen Männer torkelten eher, das hob sich gegenseitig auf, sodass es letztendlich auf das gleiche Maß an Eleganz, an Geschmeidigkeit hinauslief, nur Sarah tanzte verbissener, als müsste sie beweisen, dass sie glücklicher sei als alle anderen zusammen. Als müsse sie beweisen, dass wir irgendwie besser seien, uns besser fühlten als die jungen Frauen, weil wir es uns erlauben konnten, einfach so zu tanzen. Heute würde ich sagen, dass das eine arrogante Perspektive ist. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau an die Szene, aber mir kommt es fast so vor, als tanzten die jungen Frauen damals eher miteinander als mit ihren Kunden, mir kommt es vor, als hätten sie die Kunden nur mitgeschleppt, während sie versuchten, das Beste aus dem Abend zu machen.
Er ist der Heinz
Heinz Rudolf (Name geändert) sagt zur Begrüßung, dass er letztens einen Hörsturz hatte. Wenn man mit ihm sprechen will, muss man das laut tun. Er ist einer dieser eher kleinen Männer, die gleichzeitig ein rundliches Gesicht haben, aber den Eindruck allgemeiner Drahtigkeit machen. Er ist angegraut, aber im Sinne von gereift, nicht von verfallen. Ich, sagt er, bin nicht interessant. Das „Haus Rose“ ist ein Laufhaus. Die Arbeit machen die Frauen, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur ein Vermieter. Ein Geschäftsmann.
Er hat ja auch fast recht: Vielleicht bin ich da RTL2-geschädigt, aber der Mann sieht nicht aus, wie einer dieser Leute, die immer Kiezkönige genannt werden, obwohl er einer davon ist. Ein kleiner Kiezkönig, zwar, einer, dessen Königreich nur eine halbe Straße umfasst – neben dem „Haus Rose“ ist er auch Vermieter des Erotik-Kino „Oase“ – aber immerhin. Es ist ja auch nur ein kleines Rotlichtviertel, mehr ein Viertelchen, das – nach einschlägigen Internetforen – nicht für seine Extravaganz berühmt ist, sondern für sein Preis-Leistungs-Verhältnis: Im „Haus Rose“, so die Meinung der Experten im Internet, kann man schonmal ein Schnäppchen machen.
Rudolf mag diese Medienbilder übrigens nicht, zumindest nicht dieses Kiezkönig-Zeug. In den Medien, sagt er, hört man immer nur von Frauenhandel, von Razzien, irgendwelchen armen Polinnen, die quasi an der Wand festgekettet werden. Das gibt es bei uns nicht. Bei Rudolf läuft alles ordentlich, gesittet, geregelt. Er hat die Eieruhren für die Zimmer gebastelt, es war seine Idee. Er trinkt keinen Alkohol. Er mag es nicht, wenn man ihn siezt. Er ist Heinz.
Es gab mal einen Heinz, der war Möbelhändler, nichts Besonderes, nur ein Mensch, der anderen Menschen ihre Sofas verkaufte, ihre Sitzgruppen, ihre Duschstangen. In den 70ern, vielleicht, es ist schon ein wenig her, lange genug, dass Heinz sagen muss: Für die die Geschichte muss ich ein wenig ausholen, wenn man ihn fragt, wie genau er es geschafft hat, vom Möbelverkäufer zum Laufhausbesitzer zu werden. Diese Leute, sagt er, und meint Leute wie sich, nur damals, früher, als er noch keiner davon war, brauchten auch Möbel. Ich habe sie beliefert. Die fuhren vielleicht andere Autos und sahen ein bisschen anders aus, aber wenn die gesagt haben, dass sie morgen bezahlen, dann haben die morgen bezahlt. Das waren Leute, die standen zu ihrem Wort.
Das ist es, was Heinz imponiert: Menschen, die zu ihrem Wort stehen. Menschen, Kaufleute, Geschäftsleute, die – wie er – einen Begriff von dem haben, was Heinz »Kaufmannsehre« nennt: Die Vorstellung von einer Grenze, die nicht überschritten wird, egal, wie viel man damit verdient. Natürlich, Heinz ist hauptsächlich Vermieter – er vermietet Zimmer an die Frauen, die darin selbstständig als Prostituierte arbeiten. Solange die ihre Miete zahlen, hat Heinz nichts damit zu tun. Er muss nur dafür sorgen, dass die Abflüsse nicht verstopft sind, dass es Strom gibt, dass es fließendes Wasser gibt, dass die Heizung funktioniert – was Vermieter eben tun. Aber gerade im „Haus Rose“ ist das, was Heinz „Kaufmannsehre“ nennt, eine ganz besondere Art von Arbeitsethos, das ihn verpflichtet, nicht einfach nur ein normaler Vermieter zu sein: Er achtet darauf, dass nicht eine der Frauen plötzlich zu Dumping-Preisen arbeitet. Er hat Security eingestellt, falls mal was passiert. Er sucht seine Mieterinnen auch danach aus, ob sie ins Haus passen, zu den anderen Frauen, er achtet auf ein gutes Arbeitsklima.
Selbstverständlich hat das auch was mit Kontrolle zu tun: Heinz will, dass alles gut läuft, so, wie er es gerne möchte: Glatt, ruhig, berechenbar. Nach seinem Ethos. Nicht nach dem von irgendjemand anderem. Das ist wie die Sache mit den Eieruhren. Sein Partner in der ersten Inkarnation des „Haus Rose“ – damals noch kein Laufhaus, sondern ein ganz traditionelles Bordell – hatte ein etwas anderes Verständnis von dem Begriff »Kaufmannsehre«. Der hat einfach, sagt Heinz, sich abends in die Tasche gesteckt, was in der Kasse war, und einen draufgemacht. Heinz hat ihn rausgeworfen und schmeißt den Laden seitdem alleine. Vom Glücklichsein, übrigens, redet Heinz nicht. Nur, dass manchmal die Mädchen aus dem Haus Rose runter kämen, ins „Baccara“, um sich beim Tanzen zu entspannen. Vielleicht ist in Heinz‘ Ethos kein Platz für Glück, vielleicht ist es nicht wichtig. Vielleicht denkt er auch einfach nicht daran, es zu erwähnen, während wir auf Tour gehen, durch das „Baccara“, und das durch das Herzstück der Hildesheimer Rotlichtmeile, durch das „Haus Rose“.
Die Geschichte einer Immobilie
Dessen Geschichte ist zum Teil die Geschichte von Kaufmannsehre, zum Teil ist es aber auch die Geschichte einer Immobilie, eines heruntergekommenen Hauses, im Grunde fast ein halber Straßenzug, dort, wo die Hannoversche Straße einen Knick macht, die Geschichte einer Immobilie, die niemand wollte. Zuerst schon, zuerst wollte Heinz sie – und kaufte sie. Es sollten Mietwohnungen werden. Die Stadt mietete – und dann nicht mehr. Es gab Wirtschaftskrisen, Versprechen wurden gebrochen, die Immobilie wurde zu einem Bordell, weil in der Straße sowieso schon das Rotlichtviertel zu keimen begann – das Pornokino „Oase“ war damals schon 20 Jahre im Geschäft. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere ist anders, tragischer: Heinz fand, dass die Rotlichtmenschen, die er kannte, ganz normale Menschen waren. Andere Autos, andere Kleidung. Aber verlässlich. Geschäftsleute. Wie er. Andere Menschen waren nicht wie er: Derjenige, zum Beispiel, der ein Mädchen aus der Klasse seines Sohnes vergewaltigte und anschließend ermordete. Ich dachte, sagt Heinz, dass ein Bordell vielleicht hilft, so etwas zu vermeiden. Er zuckt die Schultern, wenn er das sagt. Vielleicht. Vielleicht nicht. Er tut, was er kann.
Alles ganz normal
Siehst du, alles ganz normal, sagt er, als er die Tür zum Aufenthaltsraum der „Baccara“-Frauen öffnet. Normalität. Auch eines von Heinz Lieblingsworten. Im Aufenthaltsraum zeigt ein Fernseher die rauschige Wiederholung irgendeiner RTL-Soap von heute Nachmittag. Jacken liegen unordentlich herum. Ein paar Brotbüchsen. Normaler geht es kaum.
Heinz hat diese Attitüde, während er durch das Haus läuft, durch die hinteren Eingeweide des „Baccara“, und eine Tür nach der anderen öffnet, diese Geste, die sagt: Hier, guck, so sieht das aus. So ist das. So läuft das. Eine Geste wie ein Schulterzucken. „Hier“, sagt er, und schiebt einen Vorhang zu Seite. „Weißt du, was das ist?“ Es ist eine gemauerte Ecke, ein paar Handschellen sind in die Wand eingelassen. Die Worte „Fuck You“ sind an die Wand gesprüht, sie leuchten im Schwarzlicht. „Oder“, sagt er, und schiebt den nächsten Vorhang zu Seite, „weißt du, was das ist?“ Ein Andreaskreuz hängt da, hinter ein paar Gummivorhängen. Laila taucht im Hintergrund auf, die Schlüssel zu den Räumen klimpern in ihrer Hand. „Das sind die Räume vom „Baccara“, sagt sie, „hier ist es teuer als drüben im „Haus Rose“. Wir haben Themenräume, Soft S/M, Dusche, Whirlpool, Mittelalter.“ Laila gestikuliert beim Reden, ihre Schlüssel klimpern. Im Baccara gibt es vier Räume, jeder eine andere übermütige Konstruktion aus Plüsch, Flokati, Spiegeln, rotem Licht, Schwarzlicht, Liebeschaukeln und übergroßen Betten. Neben jedem Bett stehen rollenweise Küchenrollen und eine kleine Holztruhe voller Kondome. Im Hintergrund wechseln sich Laila und Heinz ab: Heinz immer mit diesem bemühten Ton, dass alles ganz normal ist, als müsste er tatsächlich noch jemanden davon überzeugen, und Laila mit ihrem Klimpern, hin und wieder sagt sie Sachen wie: „Das ist meine Peitsche“, und streicht über dabei mit den Fingern über ein weißes Kunstlederteil, das mit Plastikkristallen besetzt ist. Alles ist aufgeräumt, sauber, frisch gesaugt, die Decken auf den Betten sind frisch glattgestrichen: Wie eine unvermietete Wohnung, frisch renovierte Räume, unbelebt, die nicht davon erzählen, was passiert ist, sondern was passieren könnte. Der Gang oben im „Baccara“ ist lang, dafür, dass es nur vier Zimmer sind, dunkel, nur von den Schwarzlichtornamenten im Rand erhellt. Am Ende des Ganges ist es Heinz, der mit seinen Schlüsseln klimpert. „Dann wollen wir mal rübergehen“, sagt er, und schließt eine Tür auf, die aussieht, als führte sie nirgends hin als in einen Abstellraum. Tatsächlich führt sie ins „Haus Rose“.
Algen und glitschiges Heu
Das erste im „Haus Rose“ ist der Geruch, noch vor allem anderen, noch bevor es die drei kleinen Stufen runtergeht in den ersten Flur: Der Geruch, und ich denke: Leichenhalle. Das ist Quatsch, klar, aber ich hatte den Geruch von Sex erwartet, archaischen Algengeruch, gemischt mit Schweiß und nassem, glitschigem Heu. Oder wie auch immer man den Geruch beschreiben soll, daran sind schon bessere als ich gescheitert. So riecht es im „Haus Rose“ jedenfalls nicht. Eher sauber, ordentlich, der Geruch von Reinigungsmitteln, daher kommt vielleicht diese Assoziation mit der Leichenhalle: Reinigungsmittel, und etwas liegt darunter, der Geruch vieler Menschen, vielleicht, die hier ein- und ausgehen, die hier ständig sind, und Zigarettenrauch. Die Geräusche sind gedämpft, als läge hier überall Teppich, hin und wieder Türenklappen, das Lachen von Frauen. Wie schaut man sich so einen Laden an? Wie ein Museum? Wie einen Zoo? Wie eine Wohnung, die man mieten möchte? Wie soll ich hier entlanggehen? Soll ich die Frauen grüßen, auch wenn sie so skeptisch gucken wie die hinten in der Ecke? Soll ich die Kunden grüßen? Kollegial? Überlegen? Ich habe keine Ahnung.
Das ist mein Papi
„Die Frauen hier“, sagt Heinz, „sind international, die kommen von überall her, viele sprechen kein Deutsch.“ „Sie hier“, sagt er, und geht in ein Zimmer, in dem eine schwarze Frau in knappem Bademantel vor einem Laptop sitzt,“ kommt aus, äh, Afrika.“ Die Frau lächelt kurz. Ein Fernseher steht vor dem Bett, daneben ein grüner Rollkoffer. Herzen an den Wänden. Plastikpop rauscht basslos aus Plastiklaptopboxen. „Hauptsächlich,“ sagt Heinz, „arbeiten hier Frauen aus dem Ostblock. Wir sind Fluchthaus, die Frauen kommen und gehen. Die wenigsten bleiben länger als zwei Jahre.“ Das Haus ist weitläufig, wir gehen nach rechts, eine Treppe runter, Bilderrahmen hängen über dem Geländer, diese barocken Rauschgoldimitationen, darin, handschriftliche Mitteilungen mit Textmarker geschrieben: Joy, Zimmer 23, sinnliche Thai-Massage. Marika, Zimmer 12, blond, jung und lieb. Jeanna, Zimmer 9, vollbusig und erfahren. „Hier informieren wir die Kunden“, sagt Heinz, „über unsere Neuheiten“, und im selben Augenblick ertönt im Hintergrund ein spitzer Schrei, und zerreißt das gedämpfte Gelächter und Gemurmel in den Fluren. Eine blonde Frau, ein Mädchen fast noch, hat uns gesehen, sie trägt einen schwarzen Jogginganzug mit Leopardenmusterbund. Sie rennt auf Heinz zu, umarmt ihn, küsst ihn auf die Wange und sagt – mit stark ostigem Akzent – in die Runde: „Das ist mein Papi.“
Sie fragt, wie alt ich bin. Ich sage 28, und sie sagt: Ich bin 22. Sie wirkt wie einer dieser Menschen, die sich mit irrer, quietschiger Begeisterung auf etwas stürzen können; so, wie gerade auf ihren Papi Heinz. Und irgendwie macht einen diese quietschige Begeisterung ein bisschen fröhlicher. Ich frage mich, ob das ihre Masche ist. Und ich frage mich, ob das Marika ist, jung, blond, lieb, das passt, das könnte sie sein. Heinz lächelt ein wenig betreten, und sagt: „Sie ist Rumänin.“
Ich muss wieder an Sarah denken, nicht an ihren Satz, aber ich frage mich, was sie dazu gesagt hätte. Ich vermute, sie hätte die Nase gerümpft, sie wäre in irgendeine Art rechtschaffenen Zorn ausgebrochen, das macht sie immer, sie würde sagen: Natürlich wird keine Frau gezwungen hier zu arbeiten, nicht von Heinz, jedenfalls. Sie würde etwas über die Gesellschaft sagen, darüber, dass sie keinen anderen Ausweg lässt, sie würde irgendein Argument, eine Argumentation riesig groß hochziehen, groß genug, dass man irgendeine Organisation gründen könnte, die sich mit dem Problem befasst und Fördergelder beantragen, aber ich glaube nicht, dass es bei der Rumänin und ihrem Papi darum geht. Sie lächelt ununterbrochen, sie lächelt Heinz an, sie lächelt mich an, und ich würde sie gerne fragen, ob sie glücklich ist, hier, ob sie tanzt, aber ich bin mir sicher, dass sie einfach nur weiter lächeln würde, und sagen würde: Ja, und mich dann fragend anschauen. Es würde nicht weiter helfen, sie zu fragen. Ich glaube, sie würde die richtige Antwort geben. Aber nicht auf interessante Art.
Keine Fenster
Über uns klappt eine Tür, ein Mann kommt raus, ein Kunde offensichtlich: Er hat tatsächlich eine Mütze tief im Gesicht, er hat tatsächlich einen Schnauzbart und einen Bauchansatz. Er geht an uns vorbei, schaut nur kurz hoch, damit er an uns vorbeikommen kann, geht so schnell wie möglich die Treppe runter. 30 Sekunden später geht dieselbe Tür desselben Zimmers noch einmal auf, eine Frau in Bademantel kommt raus, geht an uns vorbei, nickt Heinz kurz zu. Heinz sagt: Lass uns mal ein Fenster aufmachen, und erst da fällt mir auf, dass es keine Fenster gibt: Nicht in den „Baccara“-Zimmern. Nicht in den „Haus Rose“-Zimmern. Nicht auf den Fluren, wo die gelangweilten Frauen rauchen. Es gibt nirgends ein Fenster, jedenfalls keines, aus dem man rausschauen könnte, es gibt nur Rahmen, die aussehen, als seien es einmal Rahmen von Fenstern gewesen, und immer ist etwas darauf geklebt: rote Folie, irgendeine halbnackte Frau.
Vielleicht steckt eine Metapher darin, etwas Symbolisches, etwas, an dem man Offenheit und Abgeschlossenheit des „Haus Rose“ erklären könnte. Heinz sagt die ganze Zeit schon, schon unten, als wir uns im „Baccara“ trafen, dass er sich wünschen würde, dass mehr Menschen kommen. Vielleicht nicht unbedingt ins Haus Rose, aber wenigstens doch ins „Baccara“, man könnte, sagt er, dort auch nur ein Bier trinken. Wie läuft das Geschäft eigentlich so?, frage ich. Heinz seufzt. Wirtschaftskrise. Samstags und zur CeBIT, da geht es. Sonst nicht so. Heinz muss ein wenig reißen, damit das Fenster aufgeht. Draußen regnet es. Es ist kalt, herbstlich. Innen, im „Haus Rose“ ist es warm. Gemütlich beleuchtet. Wollen wir mal runtergehen?, fragt Heinz.
Gleich das erste Schaufenster im Neonlicht
Unten treffen wir Julia. Julia spricht Deutsch, sie ist Deutsche, der Typ Mädchen, junge Frau, die damals lieber mit ihrer besten Freundin auf die Realschule wollte, als es auf dem Gymnasium zu versuchen, jedenfalls erinnert sie mich an jemanden, den ich einmal kannte, die genau das getan hat. Sie sitzt in einem Schaufenster, es gibt eine ganze Reihe davon. Julia hat gleich das erste, wenn man in die Straße mit dem Neonlicht einbiegt. Sie macht das Fenster auf, wenn ein Kunde vorbeikommt. Wenn sie sich über den Preis einig werden, nimmt sie ihn mit hoch. Wenn nicht, oder wenn er komisch ist, dann macht sie das Fenster wieder zu.
Ihre hohen Schuhe, eigenartige Modelle mit wuchtigen Hacken und roter Spitze, hat sei ausgezogen und neben ihren Barhocker gelegt. Hinten auf dem Regal steht ein Teddybär, ein Glücksbringer, vielleicht. Daneben eine Schachtel Schokomüsli. Wenn man sie fragt, ob es ihr gut geht, ob der Job ihr Spaß macht, sagt sie, dass das Arbeitsklima gut ist. Wenn man sie fragt, ob die Frauen sich untereinander Konkurrenz machen, sagt sie: „Wir sind alle so unterschiedliche Typen, das passiert nicht.“ Es kommt darauf an, was die Kunden wollen. Wollen die nicht alle nur junge Frauen? Sie lacht. „Nein“, sagt sie, „die wollen alles Mögliche.“ Manche wollen ältere, erfahrene Frauen. Die wenigsten wollen junge Frauen, nur manchmal, alte Männer, die fragen direkt danach. Aber das findet Julia eklig.
Und was wollen die Kunden von ihr? Manchmal, sagt sie, käme einer, der wolle sie einfach nur massieren. Manchmal würde sie zum Essen eingeladen. Manchmal abends in ein Hotel, mit Fernsehen, Essen ins Zimmer, ein bisschen Sex, gemütlich einschlafen. Manche wollten einfach nur Nähe, einfach nur umarmen. Manche seien schüchtern und wüssten überhaupt nichts. Manche zögen sich aus, legten sich aufs Bett und wollten einfach nur den Service. Das seien meistens die, bei denen es nur zwei Minuten dauerte. Julia kichert, als sie das sagt. Ist der Job nicht hart? „Schon hart“, sagt Julia, und zuckt mit den Schultern.“ Ich bin ja die ganze Zeit Schauspielerin“. Die ganze Zeit? „Ja“, sagt sie, nur manchmal, da ginge es nicht anders, da fiele sie in sich selbst zurück, in die Person, die sie wirklich sei.
Erkenntnis kostet extra
Es regnet immer noch draußen, als wir gehen, durch den Regen, der in der bunten Neonschrift glitzert, und ich verstehe die Männer, so wie Julia sie mir erzählt jedenfalls: Ich verstehe die Leute, die zu ihr, zu einer anderen kommen, weil sie – wie Julia sagt – unkompliziert Druck loswerden müssen. Ich verstehe die, die allein sind und ein bisschen Nähe suchen, und sei sie noch so gespielt. Das „Haus Rose“ ist ein eigenartiger, fast altbackener Ausweg für beide Probleme, aber ich verstehe immerhin die Probleme. Heinz sagt, die Frauen verdienen zwischen 1.000 und 10.000 Euro im Monat, aber ich bin mir nicht sicher, ob es darum geht. Das ist der Punkt an dem Text, an dem ich ein Fazit ziehen müsste, an dem ich sagen müsste: Ich war da, jetzt verstehe ich alles besser. Tue ich aber nicht. Vielleicht kostet das extra.
Sarah und ich, wir haben aber auch das „Paradise“ nicht verstanden, obwohl es heute für mich auch einen anderen Geschmack hat. Auch, als sie vom Tanzen zurückkam, ein wenig verschwitzt von der tropischen Luft, wir einen Gin-Tonic nach dem anderen tranken und beobachteten, wie sich die schwarzen Frauen mit ihren weißen Männern in genau dieselben Ecken zurückzogen wie wir, wie sie sich auf dem roten Plüsch übereinanderstapelten. Sie waren noch da, als wir gingen, hatten sich nicht aus ihren Ecken bewegt, sie waren nur immer lauter geworden. Sarah und ich, wir torkelten aus dem „Paradise“ ins nächste Taxi und überließen es dem Fahrer, einen Weg nach Hause zu finden, und vergaßen dabei kurzzeitig, dass es auf der anderen Seite des Äquators lag.
Bildquellen
- _MG_3507: Bildrechte beim Autor
- _MG_3471: Bildrechte beim Autor
- titelrotlicht5: Bildrechte beim Autor
- _MG_3505: Bildrechte beim Autor
- titelrotlich10: Bildrechte beim Autor
- titelrotlich13: Bildrechte beim Autor
- IMG_3390: Bildrechte beim Autor


 Jan Fischer
Jan Fischer